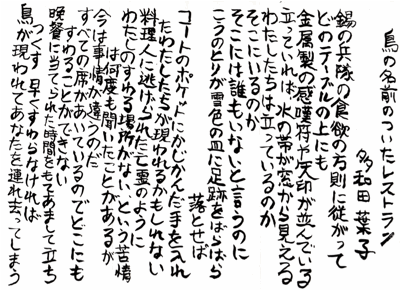
Sonderzeichen Yoko Tawada: Ein Briefwechsel zwischen Susan Bernofsky und Bernard Banoun
Sonderzeichen Yoko Tawada: Ein Briefwechsel zwischen Susan Bernofsky und Bernard Banoun
Download PDF
Abstract:
An exchange of letters, written in German, between Bernard Banoun and Susan Bernofsky, addressing issues relating to translation, and particularly to their translations of the works of Yoko Tawada into French and English, respectively.
7. März 2010
Liebe Frau Bernofsky, lieber Herr Banoun,
Vielen Dank für Ihre Teilnahme an diesem Gespräch. Bei Ihren beiden Berkeley-Besuchen in den letzten Monaten sind viele interessante Fragen aufgeworfen worden, die sowohl mit Ihren Übersetzungen der Werke Yoko Tawadas als auch mit den Themen Übersetzung im Allgemeinen und Multilingualismus zu tun haben. Wir haben Sie deshalb zu einem E-Mail-Dialog eingeladen, um diesen Fragen weiter nachzugehen und um Tawadas Texte aus der Sicht ihrer amerikanischen Übersetzerin bzw. ihres französischen Übersetzers zu betrachten. Schon hier muss man eigentlich präsizieren, da Sie sich beide vor allem mit Tawadas deutschsprachigen Texten beschäftigt haben.* Der Roman Das nackte Auge, den Sie beide übersetzt haben (engl. The Naked Eye; fr. L’Œil nu) ist ein besonders interessanter Fall, weil Tawada das Buch zum Teil auf Deutsch, zum Teil auf Japanisch geschrieben, und diese Teile dann selbst in die jeweilig andere Sprache übersetzt hat.
Vielleicht können wir also mit dieser Frage der Mehrsprachigkeit anfangen: wird der Übersetzungsprozess durch diese Mehrsprachigkeit besonders schwierig – oder besonders anregend – gemacht? Was für eine Auswirkung hat es auf diesen Prozess, dass der „Ausgangstext“ z.T. schon eine Übersetzung ist? Oder ist das eigentlich nur ein zugespitzter Fall des normalen Übersetzungsprozesses? Diese Fragen können Sie gern als Ausgangspunkt nehmen, aber sicherlich haben Sie einander auch viel Anderes zu sagen. Wir danken Ihnen nochmals herzlich für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Gespräch.
Die TRANSIT-Redaktion
* Bernard Banoun hat auch mit Ryoko Sekiguchi an einer Übersetzung eines japanischen Romans Tawadas ins Französische unter dem Titel Train de nuit avec suspects zusammengearbeitet.
***
7. März 2010
Dear Susan, chère Susan,
an diesem Sonntag Abend im März – diesseits des Ozeans, bei dir ist es ungefähr 6 Stunden früher – fange ich also diesen Briefwechsel per E-Mail an. Mit einer Anrede auf Englisch und Französisch, und es soll meinerseits dabei bleiben mit dem Versuch, mich hier auf Englisch zu äußern. Darf ich eingangs daran erinnern, dass wir uns vor 10 Jahren – glaube ich – in Deutschland kennengelernt haben, es war bei einer Übersetzerakademie des Literarischen Colloquiums Berlin (LCB) am Wannsee. Da wir uns beide vor der internationalen, multilingualen Runde als Tawada-Übersetzer vorgestellt hatten, sind wir um so schneller ins Gespräch gekommen. Andere gemeinsame Unternehmungen waren in dieser Woche eine gemeinsame Fahrt nach Wilhelmshorst ins Peter-Huchel-Haus, wo Lutz Seiler wohnt, und viel näher, zu Fuß erreichbar, zum Grab eines der „Tawada-Dichter“: Kleist. Diesen drei Dichtern sind wir treu geblieben! Da wir in Berkeley zeitversetzt zugegen waren, werden wir das Versäumte hier nachholen. Wir könnten das Projekt – sehr unbescheiden – Sonderzeichen Yoko Tawada nennen, den Titel Sonderzeichen Europa paraphrasierend, unter dem letztes Jahr Yoko Tawada ihren Briefwechsel mit László Márton veröffentlichte. Soweit für heute. Nächstes Mal tauche ich richtig in das Thema ein.
Liebe Grüße aus der Gegend von Balzac, Rabelais und Ronsard und Bonnefoy
Bernard
*
13. März 2010
Lieber Bernard,
ich danke dir sehr für den lieben Brief sowie für den allerdings etwas erschreckenden Hinweis, wie lange das alles schon zurückliegt – unsere erste Begegnung am Wannsee fand tatsächlich vor ca. 10 Jahren statt. Den Tag in Wilhelmshorst bei Lutz Seiler werde ich nie vergessen. Ich hatte damals angefangen, einige von seinen Gedichten zu übersetzen, die sehr schön und auch zum Teil sehr stark an die Landschaft außerhalb von Gera in Thüringen gebunden sind. In Wilhelmshorst haben wir mit dem Dichter im Freien sitzen können, und das war ein schönes Pendant zu den Literaturgesprächen am LCB, die zum Teil auch im Garten mit Blick auf den See stattfanden. Inzwischen bin ich ein paar Mal wieder nach Wannsee zurückgekehrt, leider ohne Dich zu sehen.
Der Titel Sonderzeichen Yoko Tawada gefällt mir gut. Du weißt es vielleicht nicht, aber das eigentliche Sonderzeichen YT befindet sich in meinem Besitz hier in New York. Es handelt sich um eine Manuskriptseite, die Yoko auf Japanisch mit der Hand geschrieben und dann abgetippt hat. Sie hat dann beide Blätter in einen großen Briefumschlag gesteckt und an mich geschickt mit der Frage „Wer schreibt schöner, ich oder mein Computer?“. Und diese Frage empfand ich nicht unbedingt als trivial. Für mich ging es um die erfreuliche Unregelmäßigkeit der Handschrift, die kein Computer hinbekommt, auch wenn man sich bei uns inzwischen bemüht, natürlich aussehende Computerschriftarten zu entwickeln, die dann meist dazu verwendet werden, Umschläge voller Reklame an die Einwohner eines Hauses zu adressieren, in der Hoffnung, diese Schrift würde für eine echte Handschrift gehalten und der Umschlag aufgemacht statt – wie es ja meistens geschieht – weggeworfen. Für mich hängt die Frage des Unvollkommen-Schreiben-Wollens mit dem Sprachgebrauch in Yokos auf Deutsch verfassten Texten zusammen. Es gefällt ihr, dass sie zwar hervorragend Deutsch kann, die Sprache aber anders spricht und schreibt, als ein Muttersprachler es tut. Diese Unvollkommenheit macht für mich einen wichtigen Teil der Schönheit der Texte aus – einen Teil aber, der sehr schwierig ist zu übersetzen. Oder wie siehst Du das?
Ich schicke dir viele liebe Grüße aus einem immer noch feuchtkalten New York, wo es aber – ich glaube fest daran – bestimmt bald frühlingt.
Die ersten Spitzen der Narzissen schauen schon aus dem Boden hervor.
Deine Susan
30. März 2010
Liebe Susan,
nur kurz: ich habe seit 2 Wochen sehr viel um die Ohren an der Uni (Probleme und Verwaltung) und habe zur Zeit den Kopf nicht frei für unseren Dialog.
Ich habe ihn aber nicht vergessen.
Susan: aus demselben Grund komme ich leider nicht nach NY.
Bis bald
Bernard
*
2. August 2010
Liebe Susan,
shame upon me!
Ich würde so gerne diesen Yoko-Briefwechsel mit dir führen und habe das Projekt, indem ich nicht geschrieben habe, obwohl ich an der Reihe war, nun verzögert.
Möchtest du auch, dass wir beide etwas gewissenhafter und vor allem regelmäßig versuchen – vielleicht binnen eines kürzeren Zeitraums aber mit nicht allzu wenigen Briefen – etwas zu Stande zu bringen?
Liebe Grüße
Bernard
*
2. August 2010
Lieber Bernard,
schreibe einfach die nächste Folge, und wir machen dann so weiter, als wäre keine Zeit verstrichen, oder?
Herzlich
Susan
*
3. August 2010
Liebe Susan,
als ich dir gestern schrieb, ich würde mich schämen, dass unser Briefwechsel gleich in den Anfängen wegen mir schon wieder abgebrochen war, so schriebst du zurück: Ich solle einfach schreiben und man würde sehen, was sich daraus ergibt.
Die praktische, logische, unkomplizierte Art deiner Antwort ist sehr à la Yoko, denke ich. Ein guter Ausgleich zur unnötigen Selbstzerknirschung des europäischen männlichen Übersetzers. Das ständige Aufschieben lag vielleicht auch daran – neben einer zugegebenen Proustschen procrastination –, dass ich eine mehrmonatige Pause in meiner Übersetzertätigkeit einlegen wollte (wobei die Übersetzung von Schwager in Bordeaux die Zeit vor der Pause abschloss), eine Art Sabbatjahr des Übersetzens, das ich mir materiell erlauben konnte; durfte ich also, von der Praxis abgekoppelt, darüber schreiben?
Ein Grund für diese Pause, eine mögliche Erklärung für das Bedürfnis, eine Zeit lang ohne das fast tägliche Pensum des Übersetzens zu leben, war auch meine wachsende Unsicherheit. Einerseits bin ich der Meinung, dass man beim Übersetzen – angenommen, man arbeitet mit Sprachkompetenz, Wachsamkeit und Genauigkeit – nicht unbedingt „Fortschritte“ macht (das Wort gefällt mir in diesem Zusammenhang nicht), aber mindestens Erfahrung sammelt und vielleicht dadurch bessere Texte in der Zielsprache produziert. Andererseits aber habe ich mich seit ein paar Jahren mit Übersetzungstheorie befasst (bis zum Anfang des Jahrtausends hatte ich gar keine Ahnung und wollte auch keine haben, denn ich ahnte, dass Übersetzungstheorie mich „stören“ würde, was sich auch als richtig erwiesen hat, wobei stören nicht negativ zu verstehen ist); und während sich der scheinbare Widerspruch zwischen source- und target-orientiertem Übersetzen aufheben lässt, solange man einen immerhin lesbaren Text herstellen möchte, so hat mich die – begeisterte, ratlose, sichdiehaareausreißenmachende – Auseinandersetzung mit Benjamins Die Aufgabe des Übersetzers zurückversetzt in den Augenblick meiner ersten Begegnung mit Yoko:
In Marseille gab es, entworfen und organisiert von der bei Aix-en-Provence lebenden Sabine Günther, eine Übersetzerwerkstatt, die jedes Jahr Schriftsteller aus Hamburg und Marseille (als Partnerstädte) einlud und sie fürs Zusammenarbeiten verpartnerte (spätestens seit Schwager in Bordeaux ahnt jeder Tawada-Leser etwas von diesen Familienverhältnissen: „Yuna [wusste] nicht nur, dass die offizielle Schwester von Hamburg Marseille war, sondern auch, dass Hamburg eine heimliche Schwester hatte: Bordeaux“). Im Laufe der Jahre nahmen u. a. Marcel Beyer, Farhad Showghi, Katja Lange-Müller, Joachim Helfer (um nur deutsche Autoren zu nennen) an der Werkstatt teil, die nach folgendem Prinzip verlief: jede(r) arbeitete mit einem Autor oder einer Autorin der anderen Sprache, um eine Übersetzung eines mitgebrachten Textes herzustellen, wobei eine deutsche Rohübersetzerin (Ulrike Bockelmann) und ein französischer Rohübersetzer (zeitweise ich) eine Fassung in der Zielsprache im Voraus angefertigt hatten. Schon die Aufgabe, eine Rohübersetzung zu liefern (ich glaube nicht, dass es das Wort Rohübersetzer auf Deutsch gibt, aber dieser barbarisme – wie man auf Französisch eine inkorrekte Wortschöpfung nennt – scheint mir für diese ausgesprochen barbarische Tätigkeit geeignet), war befremdend: Soll man „wortwörtlich“ übersetzen, und was heißt das? Was macht man mit der Syntax? Muss sie auch roh behandelt werden oder passt man sie stillschweigend der Zielsprache an? Wie soll man mit Wortspielen, polysemen Stellen in Prosatexten, und noch schlimmer: in Gedichten, umgehen? Kurz: Die Möglichkeit eines degré zéro der Übersetzung, die Idee, es könne eine sozusagen harmlose, durchsichtige Textfläche fabriziert werden, die dann literarisiert werden sollte, erwies sich als eine – höchst interessante und produktive – Täuschung und die Zusammenarbeit zwischen Autoren und Übersetzern war oft spannend, denn indem jede der zwei Funktionen „Übersetzer“ und „Dichter“ je einer Person zugesprochen wurde, wurde die Vorstellung, nach der nur ein Dichter einen Dichter übersetzen kann, auf die Probe gestellt und die Grenzen der „Aufgabe“ des plötzlich mitten in seiner Arbeit aufgegebenen Übersetzers gleichzeitig hervorgehoben und in Frage gestellt. Der Höhepunkt kam, als Yoko vorschlug, für die abschließende Lesung in Hamburg eine streng wortwörtliche, die Syntax ignorierende, kurz: eine im Sinne Benjamins interlineare Übersetzung der französischen Autorin vorzulesen: Die Dichterin selber wurde roh, die Übersetzerin konnte endlich in Ruhe arbeiten. Ich wurde meinerseits von diesem Blitz nicht direkt getroffen, da die Autorin, für die ich in meine (rohe und ungewürzte) „Muttersprache“ übersetzt hatte, zusammen mit mir Yokos Text dann mit Düften und Kräutern der Provence versah, ohne ihn zu verkochen, bevor sie die ganze Sprachgesellschaft zu sich am Fuß der Montagne Sainte-Victoire zum Rosmarin- und Thymiansorbet einlud.
Bevor ich hier weiter monologisiere und mich in Vergangenheitsbildern wälze, möchte ich dir abschließend schreiben, dass die Idee einer hier von Yoko Tawada vertretenen Übersetzung „an der Oberfläche“ des Textes mich seitdem sehr beschäftigt; während ich den zu übersetzenden Text immer mehrmals lese, um ihn zu „verstehen“, bevor ich mit dem Übersetzen anfange, sage ich mir manchmal, dass das resolute Nicht-Verstehen(-Wollen) auch zum Übersetzen gehört. Ohne dass wir hier zu theoretisch werden: Sind dir solche Gedanken auch nicht ganz fremd? Oder willst du mir lieber in eine ganz andere Richtung antworten?
Liebe Grüße aus der Touraine, wo ich gerade wieder angefangen habe zu übersetzen, selbstverständlich ohne irgendeine dieser Fragen gelöst zu haben
Bernard
*
16. August 2010
Lieber Bernard,
eben frage ich mich, einem plötzlichen Einfall folgend, ob Dein Name nicht etymologisch verwandt ist mit dem Namen der Stadt Bern, wo ich mich wieder einmal im Winter aufgehalten habe, um Robert Walser-Forschung zu betreiben. Bern ist eine sehr schöne Stadt und hat den Namen meines Wissens von dem Bären auf dem Stadtwappen (und von dem Bärengraben neben der Altstadt).
Außerdem fällt mir auf, dass wir im letzten halben Jahr einen ähnlichen Drang verspürt haben: nämlich, die Übersetzerei eine Zeitlang liegenzulassen. In meinem Fall war das so: Im Unterschied zu meiner bisherigen Laufbahn, die aus einem stetigen Abwechseln zwischen Übersetzung und Universitätsunterricht bestand, lebte ich zwei Jahre lang als freischaffende Übersetzerin, mit dem Ergebnis, dass ich viel mehr übersetzte als je zuvor, und am Ende hatte ich das Gefühl, dringend eine Pause zu benötigen, denn das Übersetzen hatte angefangen, mir keinen Spaß mehr zu machen. Also legte ich eine Auszeit von einem Dreivierteljahr ein und erzählte allen interessierten Verlagen, dass ich bis Ende 2010 ausgebucht sei und erst danach wieder neue Verträge annehmen könne. Ich ruhe mich also zurzeit als Übersetzerin aus und merke, wie gut mir das tut. Ich habe nun wieder Lust zu übersetzen und freue mich auf das neue Übersetzungsprojekt, das ich im Winter anfangen werde: eine Neuübersetzung der „Schwarzen Spinne“ von Jeremias Gotthelf. Kennst Du die Geschichte? Sie ist schön gruselig. Gotthelf wollte, dass seine Gemeinde (er war unter anderem Pfarrer) schön fromm sei, also schrieb er eine Geschichte, in der nur der Glaube an Gott retten kann. Das Ungeheuer (es handelt sich um eine Riesenspinne, die sich auch ganz klein machen oder sich vervielfachen kann) erwischt einen nur in dem Augenblick, in dem man nicht glaubt. Schön, nicht? Die Geschichte ist auch unglaublich elegant erzählt – die Figuren gut geschildert, die Beschreibungen stimmig und spannend. Ich freue mich sehr auf das Buch – bin sogar ungeduldig, damit anzufangen, und diese Ungeduld ist ein schönes Gefühl.
In meiner Auszeit schreibe ich selber mehr als zuvor, und das ist auch eine schöne Sache. Ich arbeite seit anderthalb Jahren an einem Roman und habe auch in den letzten Monaten wieder angefangen, Kurzprosa zu schreiben, wofür ich früher keine Zeit hatte. Wie sich das Schreiben zum Übersetzen verhält, ist auch eine spannende Frage. Denn das wahre Übersetzen ist meines Erachtens vor allem ein Schreiben, das sich in allen Dingen am Originaltext orientiert – aber wenn es nicht auch ein Schreiben ist, so wirkt der Text der Übersetzung fad und leblos. Das sieht man in manchen Übersetzungen – die Texte leben nicht, es gibt keinen Duktus, keinen Rhythmus in der Sprache und in der Art und Weise, wie Sätze zusammengesetzt werden. Sie gleichen also den Rohübersetzungen, von denen Du sprachst. An eine Rohübersetzung stellt man wenige Anforderungen. Man verlangt nicht, dass sie spannend, schön, sperrig und auch irgendwie gelungen sei. Und aus einem solchen Wisch soll man Schönes basteln? Das ist ja die Kunst des Schreibens, die auch jedem wahrhaftigen Übersetzen innewohnt. Ich werde selber mit solchen Rohübersetzungen in diesem Herbst arbeiten, denn ich bin von der Columbia University eingeladen worden, eine Art vierwöchiges Schnupperseminar, eine sogenannte „master class“ abzuhalten, bei der sich Magisterkandidaten im Fachbereich Creative Writing mit dem Literaturübersetzen beschäftigen können – auch solche, die keiner Fremdsprache mächtig sind. Mit diesen Studenten werde ich mich vor allem mit dem Übersetzen als Schreiben beschäftigen. Auch wenn sie danach nicht selber weiter übersetzen, werden sie daraus viel lernen, was das Handhaben der eigenen Sprache betrifft. Im Schreiben weiß man oft nicht (vor allem als angehender Schriftsteller), was für eine Sprache man erschaffen will, was für einen Stil. Beim übersetzten Text hat man genaue Vorgaben, wie der Text am Ende aussehen soll. Gar nicht so einfach, einen ganz bestimmten Ton zu treffen, den man im Ohr hat. Ich finde das eine ausgezeichnete Übung für einen jungen Schriftsteller. Und wer weiß: Vielleicht wird der eine oder der andere am Ende Übersetzer. Das wäre auch schön.
Yoko hat mir gerade geschrieben und auch von Knut gegrüßt. Das gefällt mir. Knut schickt mir auch seit einiger Zeit regelmäßig Postkarten, die Yoko für ihn abschreibt. Weil es ja mit Tatzen schwer ist, einen Stift zu halten. Dafür muss man Verständnis haben.
Ich grüße Dich ganz herzlich aus einem gerade leicht verregneten New York
Deine Susan
*
24. August 2010
Liebe Susan,
Danke für deinen Brief. Um auf deine erste Bemerkung zu antworten: Irgendwie muss ich mit BER(li)N verwandt sein, nicht nur weil ich diese zwei Städte mag, diese zwei unkonventionellen Hauptstädte (obwohl ich nur einmal in Bern war, gefiel mir die Stadt sehr gut), sondern vielleicht tatsächlich auch dem Namen nach: Als Kind bekam ich einmal als Geschenk eine Art Schale oder Teller, auf der die Bedeutung meines Vornamens erklärt wurde (es war damals Mode, Frühstückstassen und andere, ähnliche Objekte mit gemaltem Vornamen zu verschenken), unter anderem die Etymologie, irgendwie „aus dem Germanischen Bär + Hardt“, ein wagehalsiger Bär; es stand auch die französische Übersetzung geschrieben: „ours hardi“, womit ich mich, muss ich sagen, nicht recht identifizieren konnte; seltsamerweise komme ich durch deine Frage auf den Gedanken, dass dies wohl meine erste Begegnung mit der deutschen Sprache oder eine der ersten gewesen sein dürfte. (NB: Da mein Nachname aber irgendetwas wie „Sohn des Fisches“ heißen soll, ist es nicht verwunderlich und eher beruhigend, dass ich kein Naturwissenschaftler geworden bin.) Da du auch von Knut erzählst, erinnerst du dich vielleicht daran, dass du selber – zusammen mit Yoko – mir eine Knut-Postkarte aus dem Berliner Zoologischen Garten geschickt hast. Sie hängt seitdem an der Kühlschranktür mit einem Magneten und ich grüße Knut, Yoko und dich also mehrmals am Tag. Ich schaue mir heute die Rückseite an, sehe, dass die Karte am 10. Juli 2007 geschrieben wurde und bemerke zum ersten Mal, dass die Briefmarke auch eine ganz in weiß gekleidete Figur darstellt: Benedikt XVI.! Passend gekleidet, ganz in Weiß wie Knut! Mir ist aber der Bär liebär, er guckt so nett und er hat bestimmt eine Seele. – Ob diese einigermaßen private und frivolen Gedanken auch in den zu veröffentlichenden Briefen stehen werden, weiß ich nicht, wir wollen die Online-Zeitschrift nicht zu einem Ort des privaten Exhibitionismus machen, wie es schon genug davon gibt, nicht wahr? Andererseits erlaubt uns der Briefwechsel, ein bisschen aus der von Lawrence Venuti thematisierten Unsichtbarkeit des Übersetzers hervorzutreten, und Übersetzer sind ja meistens einsam zu Hause, mit leisen Wörterbüchern und Nachschlagewerken sitzende und zwischen rumorendem Kühlschrank und piepsendem Computer arbeitende Menschen.
Was du von der Beziehung zwischen Schreiben und Übersetzen schreibst, finde ich sehr interessant. Ich finde es bemerkenswert, dass die Columbia University eine Übersetzerin für das Fach Creative Writing einlädt (das Wort Schnupperseminar finde ich nett: hat das auch mit Bären zu tun?); es wird die angehenden Schriftsteller sowohl für ihr eigenes Schreiben wie auch für die Fragen ihrer künftigen Übersetzer empfindlich machen. Übersetzen als Schreiben ist ein heikles Gebiet. Was mich persönlich angeht, so ist das Übersetzen gleichzeitig Ersatz für literarisches Schreiben und sprachlich kreative Ergänzung zum wissenschaftlichen Schreiben (ich hoffe sehr, bald Texte von dir zu lesen und – warum nicht – zu übersetzen oder an Übersetzer weiterzuleiten). Aber manchmal wurde mir gesagt, eine Übersetzung von mir würde sich lesen, als sei der Text „auf Französisch geschrieben“ worden. Es ist wohl immer als Lob gemeint, befremdet mich aber immer wieder, denn ich bin nicht unbedingt der Meinung – dies gilt mindestens für die Art Texte, die ich übersetze –, dass ein übersetztes Buch durchsichtig sein dürfe, dass der Übersetzer sich ganz zurückziehen solle: einerseits, weil ich bei einer solchen Reaktion vermute, dass die Übersetzung etwas zu flüssig ist, während der Originaltext es nicht unbedingt ist, so dass ich ihn also doch „verraten“ habe; andererseits, weil diese Vorstellung eines leicht zu lesenden Textes einer irreführenden und schließlich unehrlichen Illusion der Objektivität entsprechen würde (und somit den Anteil an Zufall, Entscheidung, bewusster und unbewusster Arbeit negieren würde). Ich bin aber ganz deiner Meinung, solange man in der Wendung „in der Zielsprache geschrieben“ der Akzent auf „geschrieben“ liegt: d. h., wenn das Übersetzen sich nicht auf die Übertragung von Bedeutungen beschränkt, sondern wenn die Nähe des Übersetzers zum Originaltext und zur Ausgangskultur, seine Vertrautheit mit der Sprache des Vorlage und seine Fähigkeiten in der Zielsprache eine wahrhaft kreative Übersetzung möglich machen, wenn also die Wahrnehmung und die subjektive Aufnahme des Originals durch den Übersetzer durch das Handwerk des Übersetzens aufgehoben (also auch beibehalten) werden. Aber das klingt alles sehr hochtrabend und prätentiös! Was hat es damit zu tun, dass die Übersetzer meistens doch „nur“ nach Worten suchen und – Hieronymus sei Dank! – immer wieder auf demütigere Gedanken zurückgeworfen werden. Ich habe gerade in diesem Sommer wieder angefangen zu übersetzen: Der Österreicher Werner Kofler (sein überwältigendes Theaterstück Tanzcafé Treblinka gibt es meines Wissens leider nicht auf Englisch) verlangt von mir alles andere als vage Gedanken zur Kunst des Übersetzens, sondern Recherchen, um österreichische Ausdrücke zu verstehen und (unter anderem) literarische Anspielungen zu entschlüsseln und wiederzugeben; was Yokos Texte angeht: so würde ich gerne ihre Poetikvorlesungen Verwandlungen übersetzen, aber was soll ich aus dem ständigen Spiel zwischen „Sprache“ und „Zunge“ machen, wenn es auf Französisch nur das einzige Wort langue gibt und ich Übersetzerfußnoten herzlich verabscheue? Zwischen Hoch und Tief, zwischen den Ufern, Seiten und Stühlen: Genießen wir die unbequeme Stellung!
Liebe Grüße aus der Touraine, wo die Tomaten überreif und die Feigen langsam reif werden
Dein Bernard
*
31. August 2010
Lieber Bernard,
es gibt soviel, was ich Dir heute schreiben will. Vorgestern saß ich ebenfalls unter einem Feigenbaum, und zwar in einem community garden hier in der Nähe – das ist eine Art Schrebergartenanlage, die man in New York öfter sieht, sie entstanden vor allem in den 70er Jahren in den Lücken, wo Häuser abgerissen wurden. Unter diesem Baum entdeckte ich mit einem Nachbarn, dass ein Feigenbaum sowohl dreilappige wie auch fünflappige Blätter hat. Also ist ein Feigenblatt nicht immer gleich Feigenblatt, und da kommt man schnell auf die Frage, ob sich dreilappige oder fünflappige Blätter zu Garten-Eden-Zwecken besser eignen, und dabei fällt Dir bestimmt ein, dass ohne diesen Adam, der in jenem Garten eine entscheidende Rolle spielte (oder glaubst Du wirklich daran, das sei alles Evas Schuld gewesen? die Geschichte hat ganz gewiss ein Mann geschrieben) alle Dinge alle bis zum heutigen Tag keinen Namen hätten, und somit würden wir uns wortlos verständigen und keine Scherereien mit dem Übersetzen haben. Was aber gleichzeitig sehr schade wäre.
Was ich Dir aber sagen wollte, ist, dass ich meine ersten Erfahrungen mit der deutschen Sprache auch via Bären machte. Denn als ich ungefähr in die dritte Klasse ging, haben mir die Eltern ein paar zweisprachige Märchenbücher besorgt, oder genauer: dreisprachige, denn der Text stand jeweils zuerst auf Deutsch und zuletzt auf Englisch da, und in der Mitte stand eine Art Zwischensprache zum Vorlesen, nämlich die deutschen Wörter so geschrieben, als wären es englischsprachige. Aus diesem Buch habe ich dann auch einmal in der Schule vorgelesen, um meinen Mitschülern mit meinen angeblichen Deutschkenntnissen zu imponieren. Dies alles geschah bestimmt, weil mein Vater als Biochemiker im Studium selber Deutsch lernen musste – wie alle ernsthaften Studenten der Chemie zu der Zeit. So wurde diese Sprache auch mir schon im zarten Alter als empfehlenswert nahegelegt. Nun ja, die Taktik hat sich als wirksam erwiesen. Aber das Seltsame an diesem Märchenbuch war, dass die erste Geschichte darin (wie ich ganz klar in Erinnerung habe) Die drei Bären hieß. Als wäre das beliebte englischsprachige Märchen Goldilocks and the Three Bears eine Entlehnung aus dem Deutschen, was ja nicht stimmt. Bei den Gebrüdern Grimm findet man keine ähnliche Geschichte vor. Also war das die erste Übersetzung ins Deutsche, die mir im Leben begegnete. Und sie hatte großen Einfluss auf mich.
Nun zu dem, was Du über das manchmal vergiftete Kompliment schreibst, eine Übersetzung lese sich wie ein Originaltext. Früher (z.B. nach meiner ersten Venuti-Lektüre) habe ich mich mehr über solche Kommentare aufgeregt als heute, obwohl sie meist von einem begrenzten Verständnis von der Tätigkeit des Übersetzers zeugen. Fragen wir uns zunächst, was es hieße, wenn sich ein Text wie eine Übersetzung lesen würde. Das bedeutete wohl entweder: etwas zu vage und fad oder aber zu sperrig und syntaktisch verzwickt. Nun, jeder Text kann solche Eigenschaften aufweisen, und niemand freut sich darüber, wenn sie aus Unbeholfenheit eher als aus künstlerischer Absicht entstanden. Wenn es sich aber um einen sogenannten Originaltext handelt, meinen wir einfach: dieser Text sei nicht sonderlich gut geschrieben. Wenn ein Leser – oder sagen wir einmal: ein kritischer Leser – einen Text liest, von dem er schon im Voraus weiß, dass es sich um eine Übersetzung handelt, neigt er eher dazu, doppelt zu lesen: einmal den Text (bzw. was er für das Wesentliche an dem Text hält) und einmal die Übersetzung. Er versucht nämlich gleichzeitig zu untersuchen, wie ihm der Text an sich gefällt und wie gelungen die Übersetzung ist. Schwierig, schwierig. Und so kommt er auch einmal in die Lage, sich den Text vorzustellen, wie er gewesen wäre, wenn er z.B. weniger sperrig übersetzt worden wäre. Bei Schleiermacher gibt es ein schönes Bild dazu: als wollte man sich vorstellen, wie ein Kind aussehen würde, wenn es einen anderen Vater gehabt hätte. (Allerdings wird bei Schleiermacher dieser Vergleich anders angewandt: für den Fall, dass man sich vorstellen möchte, wie ein Text aussehen würde, wenn er ursprünglich in einer anderen Sprache geschrieben worden wäre.) Originaltexte können aber so verschieden geschrieben werden, so schwierig und sperrig bzw. so lyrisch und glatt wie sie nur sein können. Und deswegen freue ich mich inzwischen, wenn mir jemand das übliche Kompliment macht, meine Übersetzungen lesen sich wie Originaltexte. Ich sage mir: dieser Mensch will mir sagen, dass ich auf eine interessante und originelle Art Englisch schreibe, was ja auch letztendlich mein Ziel ist. Meine Mutter ärgerte sich regelmäßig während meiner Kindheit, wenn ihr jemand damit ein Kompliment machen wollte, dass ihre Töchter schön seien. Sie meinte immer: Das sind intelligente und spannende Kinder, warum wird immer wieder auf deren Schönheit verwiesen? Inzwischen denke ich: Etwas als schön gelobt zu bekommen, ist auch nicht das Schlechteste. Wir können die Menschen mit langwieriger Mühe umerziehen, damit sie uns in Zukunft intelligentere und spannendere Komplimente machen. Oder uns sagen: Sie wollen uns einfach mitteilen, dass ihnen unsere Übersetzungen gefallen. Was ja schön ist.
Diese Woche fange ich an, am Queens College, das zur City University of New York gehört, ein Seminar über das Literaturübersetzen zu unterrichten. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich berichte Dir nächste Woche mehr davon.
Viele ganz herzliche Grüße
Deine Susan
*
6. September 2010
Liebe Susan,
deine Frage bezüglich Adam und Eva wage ich nicht zu beantworten; es könnte ja zu endlosen theologischen Diskussionen führen, für die ich gar nicht zuständig bin. Es ist mir jedenfalls immer aufgefallen, dass das Benennen der Pflanzen, Tiere und Dinge durch den Menschen, der noch nicht „der Mann“ heißt, ganz kurz bevor „das Weib“ (nach Luthers Übersetzung) da ist, in Gang gesetzt wird; es wird aber nicht gesagt, ob die Frau danach nicht selber Tiere und Gegenstände benennt, und das, was verschwiegen wird, muss nicht inexistent sein; man muss es nur irgendwann geltend machen und zur Sprache bringen; jedenfalls – und dies ist sogar eine textnahe Interpretation der Bibel – verdanken wir Eva die Neugier (auch die intellektuelle Neugier), die Lust (auch die Lust, sich nicht einfach end- und zeitlos im Paradies zu langweilen, ohne zu lesen, ohne sich unterhalten zu können, aus dem einzigen Grund, dass man wie Adam von Gott in diesen Garten „gesetzt“ [1. Moses, 2, 8 und 15] worden ist) und viele andere spannende Dinge. Rose Ausländer hat eine Reihe von sehr interessanten, „feministischen“ Gedichten um den Mythos Eva geschrieben – bei dieser Gelegenheit kann ich es mir natürlich nicht verkneifen, hinzuzufügen, dass ich kein begeisterter Leser von Ausländers Lyrik bin, aber ich versichere es dir: Es mag auch männliche Dichter geben, die ich nicht schätze. – Eine Dichterin wie Yoko Tawada ist eben auch eine „Nennerin“, die durch das nachbabelische Aufdecken der Vielfalt und Durchlässigkeit der Sprachen auch auf eine paradiesische Sprache hinweist; ich denke hier vor allem an solche Texte wie Eine leere Flasche, Musik der Buchstaben oder auch ihre Essays zu Paul Celan.
Was unsere Diskussion zu den Urteilen angeht, die über Übersetzungen gefällt werden (ob eine Übersetzung als „schön“ bezeichnet werden dürfe oder nicht), stiess ich vor ein paar Tagen auf einen Satz Alfred Döblins in einem Brief an Herwarth Walden 1905 (ich bereite zur Zeit eine Vorlesung über Döblin vor): „Die Kritiker missverstehen einen zum größten Teil auch, wenn sie loben; das Recht zu tadeln vollends haben nur ganz ganz wenige.“ Dass jemand oder etwas schön sei, darüber sollte man sich nie beklagen. Um das, was ich in meinem letzten Brief geschrieben habe, zu präzisieren oder zu korrigieren: Es ist in der Tat eher ein Problem der Literaturkritiker als der „normalen“ Leser. Wenn in einer Rezension steht, dass eine Übersetzung „schön“ oder „gut“ ist, so will es ja nicht viel heißen; vielleicht nur, dass es nicht nach Übersetzung „riecht“ (wo bleibt dann aber das Schnuppern?), dass man leicht vergisst, es handle sich um einen Text aus einer anderen Sprache und Kultur, was meiner Meinung nach nicht unbedingt wünschenswert ist. Es wird heikler, wenn die Übersetzung in einer Rezension getadelt wird, denn meistens wird sie dann mit einem Adjektiv, höchstens mit ein oder zwei Sätzen abgefertigt, und dies reicht bestimmt nicht, um ein fundiertes und überzeugendes Urteil abzugeben. Denn vielleicht ist Übersetzung insofern eine „Kunst“, als eine gute Übersetzung nicht unbedingt glatt, perfekt und fehlerfrei sein muss, genauso wie umgekehrt die Summe der guten „Einfälle“ und „Lösungen“, die der Übersetzer gefunden hat, nicht unbedingt ausreicht, um ein befriedigendes Ergebnis zu liefern. Damit will ich nicht den Übersetzer für alles entschuldigen und Willkür herrschen lassen; sondern ich denke, dass es nicht nur eine einzige gute Übersetzung gibt, sondern durchaus mehrere geben kann, solange sie der eigentlich ganz vernünftigen und offenen Formulierung in französischen Übersetzerverträgen entsprechen: Der Übersetzer muss einen gewissenhaft und sorgfältig hergestellten literarischen Text liefern.
Gestern früh erhielt ich Christine Ivanovics Band Yoko Tawada. Poetik der Transformation, der voller Schätze zu sein scheint und gleichzeitig eine Sammlung der Tawada-Rezeption bildet und viele Anregungen zum weiteren Lesen und Forschen enthält. Mit Freude stellte ich fest, dass unsere Beiträge nacheinanderstehen. Gerne würde ich mich mit dir – hier in diesem Briefwechsel, wenn es zeitlich reicht, oder in einem anderen Rahmen – weiter über die Übersetzbarkeit des „Entwurzelten“ in Yokos Texten wie auch der (Pseudo?-)Einfachheit unterhalten. Du schreibst: „The novel’s language poses a challenge to the translator because it so often feels linguistically uprooted: The text makes heavy use of relatively short declarative sentences reminiscent of those used by someone just learning a language, and communicates the tale’s bizarre twists with relatively straightforward vocabulary, seemingly rejecting the notion of ‚literary‘ style.“ Ende letzten Jahres hatte ich eine Werkstatt mit Yoko an der Universität Nantes und ich hatte vorgeschlagen, dass wir uns mit Passagen aus Opium für Ovid befassen, weil dieser Roman in meinen Augen zu wenig Beachtung fand. Die Studenten waren befremdet, wie „einfach“ der Text zu übersetzen sei, wie wenig Spielraum es für andere Lösungen (mindestens in den diskutierten Stellen) gäbe, und ich war selber nicht mehr sicher, ob die Einfachheit des französischen Textes auch so sinnvoll sei. Am liebsten würde ich den Roman selber nochmals übersetzen.
Liebe Grüße
Bernard
*
26. September 2010
Lieber Bernard,
kann es wirklich schon soweit sein, dass sich dieser offizielle Briefwechsel dem Ende zuneigt? Schade. Ich will noch viele, viele Briefe mit Dir wechseln. Das, was Du über die vermeintliche semantische „Einfachheit“ bei Yoko Tawada schreibst (und auch in Deinem Beitrag aus dem neuen Sammelband mit der „Sprache als Fremdes“ und mit der „Vermischung der Sprachen im Text“ ansprichst) erinnert mich an etwas, was letzte Woche in meinem Seminar zur Literaturübersetzung am Queens College zur Sprache kam. Ein Magisterstudent, der an diesem Seminar teilnimmt, übersetzt gerade Lieder von Yusuff Khan, der auf Bhojpuri schreibt – das ist eine mit dem Hindi nah verwandte Sprache. Khans Texte sehen sehr einfach aus, aber in den Bildern vom Haus, vom Neem-Baum, vom Rad steckt ein implizierter religiöser, familiärer und geschichtlicher Hintergrund, der jedem Hörer in der Originalsprache sofort einleuchtet. Wir haben im Seminar überlegt, ob es denn übersetzungstechnisch „orientalistischer“ wäre, diesen ganzen Hintergrund mit zu übersetzen oder ihn auszulassen, um die schlichten, poetisch anmutenden Bilder des Liedes für sich selber sprechen zu lassen. Am Ende habe ich den Studenten gebeten, zwei getrennte Übersetzungen von einem dieser kurzen Texte vorzubereiten –eine, die so schlicht und „einfach“ ist, wie im oberflächlichen Verständnis des Originaltextes, und eine voller Anspielungen. Wir werden dann sehen können, inwieweit uns die beiden Fassungen einen besseren Überblick über die Vorzüge der möglichen Ansätze geben können. Ein Beispiel für eine solche „thick translation“ (so der Titel eines spannenden Essays zur Übersetzung von Kwame Anthony Appiah) leistet Gayatri Chakravorty Spivak, die uns in ihrem Aufsatz „The Politics of Translation“ vormacht, wie eine „nicht orientalische“ Übersetzung eines bengalischen Liedes von Ram Proshad Sen aussehen könnte. Darin kommen auch diese Zeilen vor: „Mind, why footloose from Mother? / Mind mine, think power, for freedom’s dower, bind bower with love-rope.“ Die entsprechenden Zeilen aus einer früheren französischen Übersetzung desselben Liedes zitiert Spivak missbilligend: „Pourquoi as-tu, mon âme, délaissé les pieds de Mâ? / O esprit, médite Shokti, tu obtiendras la délivrance.“ Als zweites Vorbild für „thick translation“ habe ich Gedichte von Gerard Manley Hopkins vorgeschlagen, dessen Sprache womöglich noch „dicker“ ist, als die der Spivak-Übersetzung. Ich bin gespannt, was dabei herauskommen wird. Es steht aber fest, dass man verschiedene Fragen an eine Übersetzung stellen kann, die sich überlappen: Stimmt der Ansatz? Stimmt die Ausführung? Erzeugt diese Kombination von Ansatz + Ausführung einen in der Zielsprache lesenswerten Text? Wenn das alles nicht stimmt, wird die Übersetzung wohl kaum ankommen. Ein Wunder, dass sich überhaupt noch Menschen trauen, zu übersetzen. Wenn ich mir das alles so konkret überlege, wird mir so bange, dass ich gar nicht weiß, wo ich den Mut hernehmen soll, mich morgen früh wieder an meinen Übersetzerschreibtisch zu setzen. Zum Glück habe ich mengenweise Abgabetermine in den nächsten Wochen, habe also gar keine Zeit, mich mit all diesen lähmenden Existenzfragen zu beschäftigen. Jaja, so ist das. Wer einmal anfängt, richtig über eine solche Tätigkeit nachzudenken, läuft Gefahr, sich selber zu überzeugen, dass er sie lieber lassen sollte. Und das wäre ja schade, denn es gibt noch so viele schöne Texte, die ich gerne übersetzen möchte. Unter anderem von Yoko Tawada, die ja gar nicht so einfach schreibt, wie es den Anschein hat, obwohl ihr immer wieder das Kunststück gelingt, einfach zu wirken. Das mache ihr einer nach! Ach ja, das tun wir jetzt schon. So gut es geht. Lieber Bernard, lieber Freund und geschätzter Kollege, wird das noch gut mit unserer Übersetzertätigkeit? Dies sehr hoffend und wünschend empfehle ich mich Dir mit meinen herzlichsten und zuversichtlichsten Grüßen
Deine Susan
*
Post-scriptum: „Oh, it’s a long, long while / From March to December, / But the days grow short, / When you reach September.“, höre ich in meinem Kopf Lotte Lenya singen. Lese ich unseren „Briefwechsel“ wieder, so fällt mir auf, dass wir relativ wenig über konkrete Probleme der Übersetzung geschrieben haben und wenige Stellen diskutiert haben. Ich hoffe, die TRANSIT-Redaktion und die Leser nehmen uns das nicht übel. Aber wir haben doch einen Einblick in unsere „Werkstatt“ gegeben. Es gäbe noch vieles zu sagen, auf einige Fragen, die wir einander gestellt haben, haben wir nicht geantwortet. Jetzt reicht die Zeit nicht mehr. Aber ich würde diesen Dialog auf eine oder die andere Art und Weise gerne weiterführen. BB


