Amerika und die deutschsprachige Literatur nach 1848. Migration — kultureller Austausch — frühe Globalisierung, Christof Hamann, Ute Gerhard, und Walter Grünzweig, Hrsg.
Reviewed by Hinrich C. Seeba
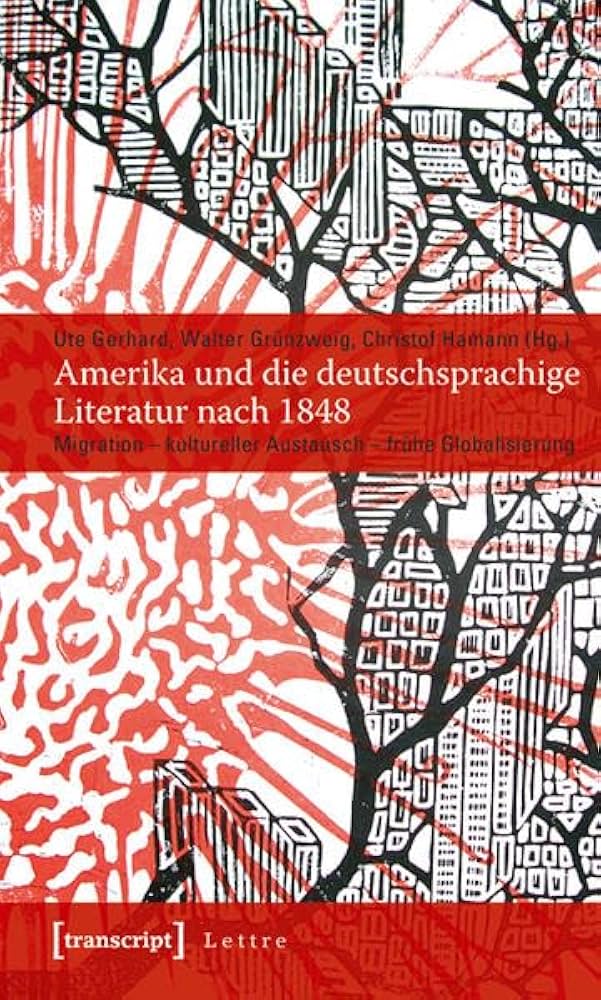
Christof Hamann, Ute Gerhard, und Walter Grünzweig, Hrsg., Amerika und die deutschsprachige Literatur nach 1848. Migration – kultureller Austausch – frühe Globalisierung. Bielefeld: transcript Verlag, 2009, 296 S., Broschiert, 29,80 €.
Wie Amerika am Anfang des 20. Jahrhunderts als Land der Zukunft gefeiert wurde, weil von seinem technischen Fortschritt neue Impulse der Moderne ausgehen sollten, diente es vielen Deutschen im frühen 19. Jahrhundert umgekehrt der Flucht aus der Geschichte und der Erinnerung an verlorene Paradiese, in denen sich die „europamüden“ Opfer lebensschwacher Selbstentfremdung wiederzufinden hofften.1 In Ernst Willkomms Roman Die Europamüden (1838) erwarten die künftigen Auswanderer, die „diese süß-behagliche Kleinbürgerlichkeit des Deutschen“ nicht mehr aushalten können, von Amerika in stark religiös gefärbten Bildern die Erlösung vom Unheil der beginnenden Moderne, „das Land der Verheißung im heiligen Schatten des Urwalds“.2 In seiner scheinbar unberührten, unerforschten und ungebändigten Wildnis wurde Amerika ersehnt und begehrt als das gelobte Land der Vergangenheit, einer im Urwald erfahrbaren „Ur“-zeit, die wie vorher das klassische Griechenland einen Ausweg aus dem deutschen Philistertum mit seiner oft einengenden Gemütlichkeit versprach.
Diesem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vorherrschenden, auf wenige Autoren wie Charles Sealsfield (Karl Postl) gestützten Phantasiebild folgte, als nach der gescheiterten bürgerlichen Revolution von 1848 innerhalb von zehn Jahren fast eine Million Deutsche nach (Nord-)Amerika auswanderten, ein an der Erfahrungswirklichkeit der Migration überprüftes Amerika-Bild, dem auch die neuen Darstellungsmittel des bürgerlichen Realismus entgegenkamen. Zwar wurden auch weiterhin, im Gefolge von James F. Cooper, die alten Pfadfinderträume bedient, bis sie in Karl Mays Phantasien um Old Shatterhand ihren populären Höhepunkt erreichten, aber wichtiger waren die geopolitischen Erkundungen des Wilden Westens auf der Suche nach der besten Eisenbahntrasse, um das 1850 der Union beigetretene Kalifornien, wo am Anfang des 19. Jahrhunderts noch russische und spanische Machtansprüche aufeinanderprallten, endgültig anzubinden. Hier spielten die Berichte von Balduin Möllhausen, dem Karl May vieles abgeguckt hat, Jacob Schiel, der 1849 den Begriff der Geisteswissenschaften (als Übersetzung von John Stuart Mills moral sciences) geprägt hat und 1853 in Utah dem berüchtigten Gunnison Massacre entkommen ist, und Heinrich Schliemann, der mit dem im kalifornischen Goldrausch gewonnenen Geld die Ausgrabung von Troja finanzieren sollte, eine (heute fast vergessene) größere Rolle als die bekannten Romanciers, die ihre Figuren dem immer stärkeren, aber immer nur sekundär erfahrenen Amerika-Sog nicht mehr entziehen konnten.
Dem Amerika-Bild dieser Periode nach 1848 ist der vorliegende Band mit insgesamt dreizehn Beiträgen gewidmet. Weil dabei die bis heute berühmten Autoren Auerbach, Spielhagen, Raabe, Keller und Fontane bei weitem den größten Raum einnehmen, wird das im Vorwort gegebene Versprechen, den (bekanntlich schon vor 40 Jahren nivellierten) Unterschied zwischen ‚hoher‘ und ‚trivialer‘ Literatur zu ignorieren und stattdessen – in poststrukturalistischem Jargon – die Texte „mit unterschiedlichen diskursiven Kontexten zu vernetzen“ (S. 13), nur begrenzt eingelöst. Abgesehen von dem offensichtlichsten Beispiel eines (1879 passend in der Gartenlaube veröffentlichten) Trivialromans von Eugenie Marlitt, Im Schillingshof (1879), dem sich Lynne Tatlock in Hinblick auf ethnische Differenzen widmet, gelten die meisten Beiträge der einst als „hoch“ kanonisierten Literatur, drei davon allein Gottfried Keller, der innerhalb der gewählten Periode wohl die bekannteste Auswanderin geschaffen hat. Die drei Artikel ergeben, zusammengenommen, eine Bestandsaufnahme der zahlreichen Amerika-Verweise im Werk Kellers. Todd Kontje behandelt die Auswirkung der, wie er meint, schon im 16. Jahrhundert beginnenden Globalisierung auf die Schweizer Provinz, die in die Ferne, auch in Kolonien, ausgreifende Horizonterweiterung der Handelsherren, Missionare und Auswanderer als kosmopolitische Herausforderung des provinziellen Patriotismus. Die in der ersten Fassung des Grünen Heinrich (1855) in Amerika einfach verschwindende Judith darf in der zweiten Fassung des Romans (1880) aus Amerika zurückkehren, damit an ihr die amerikanische Läuterung der einstigen Verführerin zur sozial engagierten Beichtmutter und Krankenschwester vorgeführt werden kann. Aber auch die Gegenfigur, Dortchen Schönfund, erweist sich in der zweiten Fassung als in der Neuen Welt geboren, als heimliche Gräfin gar, die statt des bürgerlichen Haupthelden Heinrich Lee nun standesgemäß einen Grafen heiratet. Ob sie damit – nicht unähnlich dem Findelkind Kleists, Käthchen von Heilbronn, das schließlich zur heimlichen Kaiserstochter geadelt wird und den Grafen Wetter vom Strahl heiratet – einen menschlichen Adel begründet, der dem heimischen Geburtsadel Paroli bietet, muss wie die an Judith vollzogene Domestizierung der Sinnlichkeit wohl eher der systemerhaltenden Phantasie des Trivialgenres als einem von Amerika inspirierten sozialen Befreiungsschlag zugerechnet werden. Kellers eher regressive Anverwandlung des amerikanischen „Zaubertrunks“ (S. 204), dem sich auch Todd Kontjes Spurensuche nicht verweigert, müsste vielleicht doch nüchterner gesehen und kritischer in Frage gestellt werden.
Abgesehen davon, dass den Herausgebern die Stilblüten nur nominell ‚diskursanalytischer‘ Fixierung (z.B. „der Darwinismus mit seinem fulminanten Marsch durch die Diskurse“ (S. 213), „Konzeption von Amerika als diskursivem Gegenstand“ (S. 215)) entgangen sind, hätte eine strengere, über das nachträgliche Vorwort hinausgehende Konzeptionalisierung der Aufsatzsammlung der immer wieder beschworenen und kaum durchgeführten „Kontextualisierung“ die nötige Substanz verleihen müssen. So verlockend der Versuch sein mag, den oft trivialen Auswanderer-Phantasien nachträglich eine mediale Absicht zu unterschieben, als „Entwürfe der transatlantischen Kommunikation“ (S. 18) sind die behandelten Romane und Berichte kaum transparenter geworden. Die Beiträge, die sich diesem erklärten Projekt nicht zuordnen lassen, sind denn auch die interessantesten. Am wichtigsten wohl, weil einem kaum mehr bekannten, zu seiner Zeit aber einflussreichen Autor gewidmet, ist Alexander Honolds Analyse zu Balduin Möllhausen, der – zwischen Alexander von Humboldts wissenschaftlicher Erkundung und Karl Mays narrativen Phantasien, die schon zur Bagdad-Bahn überleiten – die Vermessung der künftigen Eisenbahntrasse an die amerikanische Westküste mit poetischen Landschaftsbildern ausgeschmückt hat.
Kulturgeschichtlich ergiebiger hätte die überfällige Studie (von Rolf Parr) zum „reichen Onkel aus Amerika“ ausfallen können, wenn dieser dramatische Katalysator im größeren ‚Kontext‘ von aristotelischer Anagnorisis über Nestroy bis Ibsen poetologische Konturen gewinnen würde und wenn er stilistisch nicht so verschroben, zum Beispiel „in Form des die ärmliche deutsche Nichte temporär zum im Nobelhotel lebenden Flapper-Girl ausstattenden reichen amerikanischen Paars“ (S. 22), daherkäme. Die auffallende Kapitalisierung, durch die sich der klassische Typus des heimkehrenden Fremden zum reichen Amerikaner verwandelt, hätte gerade im Rahmen nationaler Stereotypisierung mehr Beachtung verdient. Der naturalisierte Amerikaner als deus ex machina, der die Bedrängten nur noch aus ökonomischer Not rettet, wäre ein bedenkenswerter Aspekt in der aktuellen Geschichte der Säkularisierung. Aber leider kommt der knapp kommentierte Überblick einschlägiger Titel, für die „der (reiche) Onkel aus Amerika“ zum Beispiel in vergessenen Bühnenstücken von Elisabeth von Grotthus (1875), Franz Grundmann (1900) und Arnold Spanke (1904) herhalten musste, über eine wenig versprechende Bestandsaufnahme nicht hinaus.
Der gemeinsame Bezug ganz unterschiedlicher Beiträge auf die Gartenlaube, für die Möllhausen, Marlitt und sogar Keller geschrieben haben, hätte einen wirklich kulturkritischen Brennpunkt aller Arbeiten abgeben können, wenn sie sich an der Vermittlerrolle der Familienzeitschriften bei der Popularisierung des Amerika-Bildes im Rahmen der (vor allem von der Mitherausgeberin Ute Gerhard angesprochenen) deutschen Identitätsbildung orientiert hätten. Leicht hätte sich die Vorgabe dafür im Beitrag des Mitherausgebers Christof Hamann finden können, der überzeugend vorführt, wie etwa in der 1853 gegründeten Gartenlaube von Anfang an das Bild der heterogenen amerikanischen Massengesellschaft (mit ihren Riesenhotels als Symbol des Nomadentums) die Kontrastfolie für die nationale Homogenisierung der deutschen Kleinbürgergesellschaft (mit ihrer Heimatliebe als Symbol der Bodenständigkeit) abgeben sollte. Hier findet sich auch das (seit Stephen Greenblatts Shakespearean Negotiations von 1988 wohlbekannte, oft beredete und selten ausgeführte) Programm einer Kontextualisierung, die, über bloß quasi-theoretisches Wortgeklingel hinaus, die kulturelle Praxis der Verknüpfung von Textspuren aufweist: „Es geht um eine Erschließung der synchronen und diachronen Verkettungen von Romanen, Novellen, Reiseberichten, Illustrationen, Rezensionen und Kurznachrichten, mit anderen Worten, um eine Erschließung des fortlaufenden Textes, den das Medium der periodischen Presse unentwegt generiert“ (S. 91). Dass die analysierten Dichotomien in der Konstruktion von Amerika-Bildern – dort „zerstreute Masse“ in Amerika und hier, gestützt auf die Familie, „kompakte Masse“ in Deutschland – unter der Hand zu analytischen Instrumentarien geraten, denen unaufgeklärt das gleiche bipolare Denken zugrundeliegt, zeigt nur einmal mehr, wie dringend auch der diskursanalytische Ansatz einer methodologisch gesicherten (Selbst-)Kritik der Stereotypenbildung bedarf. Diesem Desiderat kommt der andere Mitherausgeber, der Dortmunder Amerikanist Walter Grünzweig, nur bedingt entgegen, wenn er die disziplintheoretische Reflexion nur indirekt in die Geschichte seiner Themenfindung einfließen lässt und, in enger Anlehnung an den Germanisten Jeffrey L. Sammons, zeigt, dass ein deutscher Autor wie Friedrich Spielhagen (mit seinem vor allem im Mohawk Valley im Upstate New York spielenden Roman Deutsche Pioniere von 1871) durchaus auch „amerikanistisch relevant“ (S. 145) sein kann, weil er einen privilegierten Zugang zum zeitgenössischen Wissen über Amerika hat, also offenbar doch mehr als nur zu dekonstruierende „Konstrukte“ liefert.
Wenn es wirklich um die politisch-historische Kontextualisierung von Literatur gehen soll, dann müsste ihr theoretisch gerne geächteter mimetischer Anspruch ernst genommen und kritisch überprüft werden. Das hat Jeffrey L. Sammons, der sich schon seit langem um eine Aufwertung des Realisten Spielhagen bemüht, noch einmal an dessen Deutschen Pionieren veranschaulicht. Der Roman, der mit seiner Quelle, der Geschichte der deutschen Einwanderung in Amerika (1868) von Friedrich Kapp (dem Vater des späteren Kapp-Putschisten und, wie Kit Belgum vermutet, Vorbild des Deutsch-Amerikaners Dr. Fritz in Auerbachs Roman Das Landhaus am Rhein von 1869), die nationalchauvinistische Gesinnung teilt, versucht den knapp hundert Jahre zurückliegenden Kampf der treudeutschen Auswanderer gegen die als gewalttätig und feige charakterisierten Franzosen und die mit ihnen verbündeten Indianer in Hinblick auf den gerade beginnenden Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71 zu aktualisieren. So kommt denn doch noch jene ideologische Instrumentalisierung in den Blick, ohne deren Kritik ein Verständnis der deutschsprachigen Literatur nach 1848 und besonders nach der Reichsgründung 1871 undenkbar erscheint. Dem Projekt nationaler Homogenisierung eines nun zentral gelenkten Deutschen Reichs musste nolens volens auch das literarische Amerika-Bild zuarbeiten: als Ort der Läuterung wie bei Keller oder als Ort der Ertüchtigung wie bei Spielhagen, als Feuerprobe für die Jüngeren und als Jungbrunnen für die Älteren, immer aber als Gegenbild des sich daran messenden deutschen Selbstverständnisses. Das von Jeffrey L. Sammons klar formulierte Fazit gilt eigentlich für alle Beiträge: „Somit kommt über das Amerikamotiv in den behandelten Romanen weniger ein Interesse am Fremden, sondern vielmehr am Eigenen zum Ausdruck. Amerika interessiert nicht an und für sich, sondern nur insofern es für Deutschland relevant ist, als ein Raum, in dem Deutsche und Deutschland unter Umständen geistig und politisch gesunden können“ (S. 169).
Eine symptomatische Randerscheinung des großenteils diskursanalytisch und weniger ästhetisch ambitionierten Sammelbandes ist die Tatsache, dass je weniger literarisch relevant die behandelten Texte sind, desto konventioneller, oft auf alte Muster der Inhaltsparaphrase zurückgreifend, ihre Behandlung ausfällt, so dass in literaturwissenschaftlicher Hinsicht der Erkenntnisgewinn deutlich hinter dem hohen Anspruch des Vorworts zurückbleibt. Letzten Endes sind es gerade beim Amerika-Thema, das den Lesern eben eine „neue Welt“ verspricht, ohne die Kenntnis der versteckten Texte voraussetzen zu können, wie eh und je doch wieder nur Inhalte und nicht deren formale Gestaltung, persönliche Beziehungen und nicht deren diskursive Vernetzung, Erfahrungen und nicht deren fiktionale Konstruktion, Einsichten und nicht deren metaphorische Überhöhung, Wendepunkte der Geschichte und nicht deren Vergegenwärtigung als representation, die den Leseanreiz ausmachen. Daraus erklärt sich vielleicht auch, warum das Amerika-Bild weiterhin nur ein Regionalthema der Kulturkritik bleiben wird und warum ausgerechnet der Rhetorik der Diskurse verschriebene Wissenschaftler selber nur noch selten die Rhetorik lesbarer Darstellung beherrschen, um ein größeres, nicht nur an Motivstudien interessiertes Publikum zu erreichen.
HINRICH C. SEEBA, University of California, Berkeley
- Vgl. das auf einer Berkeley-Dissertation beruhende Buch von Theresa Mayer Hammond, American Paradise: German Travel Literature from Duden to Kisch, Heidelberg: Winter, 1980. ↩︎
- Ernst Willkomm, Die Europamüden. Modernes Lebensbild, 2 Bde., Leipzig: Julius Wunders Verlags-Magazin, 1838, Bd. 1, S. 129 und 353. ↩︎
